San Benedetto in Conversano, Apulien
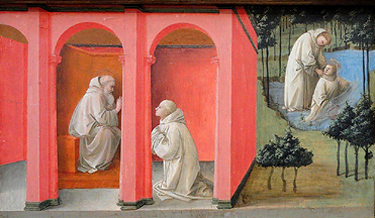
Filippo Lippi, Benedikt befiehlt Maurus die Rettung von Placidus, ca. 1445
Im 2. Buch der Dialoge Gregors
des Großen (540- 604) findet sich die Beschreibung einer höchst
wunderbaren Begebenheit: Eines Tages [lange bevor er dann im Jahr 529
die Abtei Montecassino gründete] weilte der Abt Benedikt in seiner Zelle
[und befand sich vermutlich in jenem Zustand, den die Mönche mit den
Worten „habitare secum“ (lat: wohnen bei/in sich selbst) beschrieben],
als er plötzlich gewahr wurde, daß sein Schüler Placidus beim
Wasserholen in den See gefallen war; eine Woge ihn sogleich erfaßt und
einen Pfeilschuss weit vom Ufer weggerissen hatte. Er rief Bruder Maurus
herbei, erteilte ihm den Segen und den Befehl, Placidus zu retten. Und
da passierte das Wunder: Wie weiland Petrus auf Weisung Jesu übers
Wasser wandelte (Math. 4, 28-29), lief Maurus über die Wellen und
rettete Placidus: Einer der beiden soll der Überlieferung zufolge in
Apulien das Kloster San Benedetto in Conversano gegründet haben.
500 Jahre später wurde in San
Benedetto, um 1100 noch Benediktiner-Abtei, ein Kreuzgang gebaut, von dem noch sechs Arkaden erhalten sind.
Nicht den anderen, größeren, besser erhaltenen Gang, in dem bereits die
strengen Bauvorschriften des Generalkapitels (Cîteaux, 1134) umgesetzt
sind, sondern dieses relativ kleine Teilstück bringt Schwering ins Bild: ein Motiv
aber, dem drei Elemente der zisterziensischen Vorstellungswelt
einverwoben sind.
So verweisen die figürlich
gestalteten Kapitelle des vorderen Abschnitts der Arkadenreihe – ein
Mönch beim Pflügen mit Ochsen / betende Engel – auf Benedikts Credo „ora
et labora“: War es doch vor allem das bei den Benediktinern ins Abseits
geratene „labora“,
das die Mönche um Robert von Molesme (Mitbegründer des
Zisterzienserordens) angetrieben hatte, sich neu zu orientieren, denn:
„Sie
sind dann wirklich Mönche, wenn sie wie unsere Väter und die Apostel von
ihrer Hände Arbeit leben.“
(Regula
Benedicti
48, 8).
Der vom
Kreuzgang umschlossene Garten galt den Menschen des Mittelalters als
„Widerschein des verlorenen Paradieses“. Und es ist denkbar, daß sich
die Nonnen, die 1266 aus ihrem Konvent Sancta Maria de Viridario
(Garten) auf dem Peloponnes hatten fliehen müssen und 1267 die von den
Benediktinern aufgegebene Abtei in Coversano neu besiedeln durften, dem
Innenhof des Klosters mit besonderer Hingabe widmeten. Ob Schwering
diese Vorstellung vor Augen hatte? Auf jeden Fall: Über die Gestaltung
der Flora – wie er z.B. die Arkaden als Fenster nutzt, um die
„erfundenen“ Blüten und Früchte zu vereinzeln, so daß ein Hauch von
kindlicher Anmutung spürbar wird, generell durch die Art und Weise, wie
er Präzision und Innigkeit verbindet – vermittelt sich etwas von der
inneren Haltung, die die Nonnen beim Hacken und Graben in ihrem „Garten
Eden“ getragen haben mag.

Bernd Schwering, San Benedetto in Conversano, Bildausschnitt 1

Bernd Schwering, San Benedetto in Conversano, Bildausschnitt 2

Bernd Schwering, San Benedetto in Conver- sano, 40 x 40 cm, 2013
Die o.a. Rettungs-Legende läßt sich lokalisieren. Gemeint ist das Kloster San Benedetto in Subiaco, das auch „Sacro Speco“ genannt wird. Und diese „Heilige Grotte“ – sie liegt heute im Inneren der Abtei – könnte man als den Geburtsort des „habitare secum“ bezeichnen.

Die Benedikt-Grotte im Kloster
Hier nämlich, in einer abgelegenen Felsenhöhle, hatte sich der junge Benedikt (um 500 etwa) für 3 Jahre als Eremit eingenistet, um jenen Zustand einzuüben, und zwar „allein, unter den Augen Gottes, der aus der Höhe herniederschaute.“ (Gregor I.) Auch wenn sich das ora et labora der Mönche primär in der Gemeinschaft vollzog, gab es gerade bei den Zisterziensern immer wieder Phasen, in denen die Idee des eremitischen Lebens stärkere Attraktivität entfaltete.
Interessant ist in dem Zusammenhang, daß die
Mittelalterforschung mit Blick auf die Jahrzehnte um 1100 einen
Mentalitätswandel konstatiert: einen „Individualisierungsschub“
verbunden mit dem „Erwachen des Gewissens“, der zügig auch die Abteien
erfaßte, da hier einzelne Elemente dieser Veränderung – Benedikts
„habitare secum“ – bereits gelebt bzw. vorgedacht waren. Es wuchs die
Überzeugung, daß das Seelenheil durch stringente Einhaltung der
klösterlichen Rituale allein nicht zu gewinnen war; von nun an sollte
jeder Einzelne seine innere Einstellung, die Tiefe seines Glaubens
selbst kontrollieren: in Zurückgezogenheit und Stille, wie sie auch die
Nischen und Ecken eines
Kreuzgangs bieten.
Beim Durchstreifen der Klosteranlage in Conversano wird
Schwering am Kreuzgang in
einen Bereich geraten sein, dessen Anhauch von besonderer Intimität
seine Aufmerksamkeit bindet; der ihn anregt, den Komponenten dieser
Wirkung nachzuspüren, sie,
wo erforderlich, durch gezielte Eingriffe zu verdeutlichen, so daß im
Bild eine Örtlichkeit sichtbar wird, die man als Idealversion einer
solchen Stätte kontemplativer Stille sehen kann, versehen zudem mit
diskreten Hinweisen zur Genealogie dieser spezifischen Klausur:
Den Arkaden-Abschnitt zeigt er in "Naheinstel-lung". Der
Betrachter ist nicht Außenstehender, sondern wird quasi im Gang
postiert; hat Mauerwerk, Säulen, die Verzierungen der Kapitelle direkt
vor Augen und das vom Sonnenlicht überstrahlte Ende des Ganges wie auch
das im Schatten liegende Gewölbe klar im Blick. Während sich die Dinge
in den Stützfotos wegen des dort herrschenden leicht dunstigen
Streulichts etwas entziehen, geraten sie im Bild – bei klarer, direkter
Beleuchtung, also auch Schärfung der Konturen – in Berührungs-Nähe. Die
waage- und senkrechten Kanten der Brüstung wie auch
die deutlich umrissenen Pfeiler, Säulenfüße und Rundbögen in
ihrer betont dreidimensionalen Präsenz, suggerieren Räumlichkeit, besser
gesagt: vermitteln Innenraum-Gefühl, eine Empfindung, die durch den
Blick nach draußen verstärkt wird. Kurzum: Es entsteht der Eindruck, als
habe Schwering imaginierte visuelle Wahrnehmungen der in ihren Grotten
hausenden Einsiedler in
seine Darstellung des Kreuzganges einbezogen. Oder ergeben sich – über
die Umsetzung komplexer Beobachtungen – derartige Verknüpfungen
zwangsläufig?