| Fritz Koch: Weltbild im Maisfeld | ||
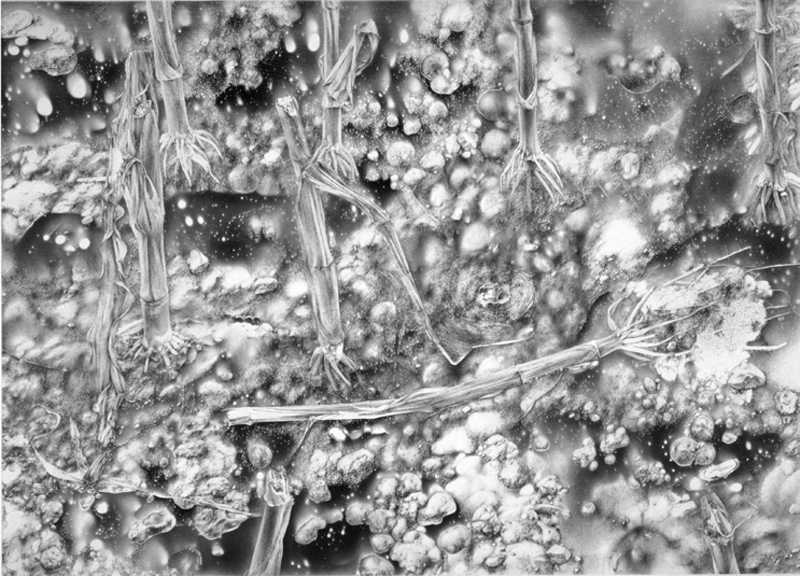 |
||
| "Maisfeld", Graphit, 51,6 x 71,8 cm, 1980/87 | ||
|
Meinen
Anmerkungen zu Fritz Koch möchte ich
drei Kurzinformationen vorausschicken: 1.
Wenn
man die Tür zu seinem Atelier öffnet, fällt der Blick nicht auf
Zeichnungen und Bilder, sondern – und das war bei meinem ersten
Besuch schon überraschend
– auf ein
ziemlich opulentes, aus Snare- und Base Drum, High Head, Right
Cymbal, Crash, Cowbell und zwei Toms bestehendem Schlagzeug. –
Vielleicht, so könnte man denken, eine Reminiszenz an vergangene
Pubertätsträume? Nein, durchaus nicht! Das Aggregat ist nach wie
vor in Betrieb, und zur Zeit interessieren ihn
verschiedenartige, gleichzeitig ablaufende Rhythmen, sogenannte
polyrhythmische patterns. 2.
Im Spätsommer Jahres 2003 war ich mit Fritz Koch auf einer
Bergtour in Graubünden. Dabei zeigte er sich als höchst
eigenwilliger Mitwanderer. Keine Begeisterungsrufe während des
morgendlichen Aufstiegs; keine Reaktion auf schöne An- und
Aussichten; Enzian, Almrausch, Mücken-Handwurz, die Highlights
der Alpenflora: auch die keiner Erwähnung wert! Dann aber, zwei-, dreihundert Meter über der Baumgrenze, angesichts
grüngrauschwarzer Schutthalden, Steinschlagrinnen und
zerklüfteter Felsformationen, deren Risse, Verschiebungen,
Spalten und Falten – ich gebe es ja zu –
sensationelle Texturen und Musterungen, also
visualisierte
Rhythmen aufwiesen, da geriet er in Stimmung, d.h., – Stativ
immer dabei –: er fotografierte. 3.
Auf der Suche nach einem seine Kunst betreffenden
Schlüsselerlebnis, nach frühen Prägungen also oder anders
gesagt: nach entscheidenden Momenten, in denen sich – mit Dürer
gesprochen – die „inwendige figur“ konstituiert, deren
Materialisierung, Objektivierung später Ziel künstlerischer
Anstrengung wird, stößt man auf entscheidende Anhaltspunkte
bereits in der frühen Kindheit, die Fritz Koch auf einem
Bauernhof in Schwarmstedt nahe der Leine verlebte. Die
alljährlichen Überflutungen im Vorfrühling mit weggeschwemmten
Misthaufen, vergammelten Rüben auf morastigen Feldern, mit
nassen Füssen in vollgelaufenen Gummistiefeln,
Kleintierkadavern, die im Gestrüpp und an Zäumen hängen bleiben,
wenn das Wasser zurückweicht, aber auch die Arbeit, die Mithilfe
beim Rübenverziehen, Kartoffeln sortieren etc., das frühe
Eingebundensein kurzum in die elementaren Vorgänge vom Säen bis
zur Ernte, wie sie – völlig unsentimental – in einer
Agrarlandschaft ablaufen: dies alles und zunächst aus
Kinderkopfhöhe wahrgenommen, scheint bei ihm bis heute
nachzuwirken. Mais, Kartoffeln, Runkelrüben! Daß sich Fritz Koch mit solchen Sujets auseinandersetzt, seine Bildgegenstände – als würde er beim Zeichnen in der Furche liegen – aus allernächster Nähe erfasst und dabei Details aufnimmt, die nie zuvor in solcher Präzision dargestellt wurden, hängt zweifellos mit dieser früh begründeten Affinität zusammen.
Über Kindheitserinnerungen sprechend, berichtet Koch von einem flachen sumpfigen Tümpel, der sich in seinem Bewusstsein eine
gewisse Leuchtkraft erhalten hat. Dieses kleine Gewässer – man
kennt die akustisch-visuellen Reize solcher Örtlichkeiten –
ist von ihm als eine
Situation erlebt worden, „wo die Dinge“, so hat es Jean Liedloff
formuliert, „waren, wie sie sein sollten“, wo eine tief
empfundene Übereinstimmung bestand: „Ich habe nie versucht“, so
Koch, „diesen Ort gewissermaßen zu porträtieren. Dennoch glaube
ich, daß meine Zeichnungen sich in sehr spezifischer Weise zu
dieser frühen Prägung verhalten. Sie zieht sich leitmotivisch
durch meine gesamte Arbeit.“
Das Realisieren also polyrhythmischer Muster via Schlagzeug, das Fotografieren ausschließlich bestimmter, vielfältig gegliederter Texturen, das Idolisieren eines Tümpels als des Künstlers Kinderstube sozusagen: mit diesen biografischen Momentaufnahmen möchte ich andeuten, daß eine besondere Affinität zu komplexen rhythmischen Strukturen besteht, um die es natürlich auch und selbstverständlich in Kochs Zeichnungen geht, an denen er Monate lang, bei größeren Formaten über Jahre hinweg arbeitet. Die minutiöse Darstellung zielt also nicht auf hypertrophierte Kartoffel-
"Hohenesch", 1992 (Ausschnitt)
und
Maisstauden-Mimesis, auf moderne Mopsverdoppelung, hat nichts zu
tun mit den perfekt welkenden Tulpen niederländischer
Vanitas-Stillleben, zielt ebenso wenig in Richtung Oelze gehende
Bilderfindungen, sondern dient dem Versuch, solche
Strukturen bis in allerfeinste Verzweigungen aufzudecken
und zum Vorschein zu bringen, d.h., jener Kongruenz
nachzuspüren, sie – via Kunst – zu
reaktivieren bzw.
herzustellen.
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, weshalb er sich vor allem mit der Metamorphose verrottender Pflanzen und Tierkadaver beschäftigt. Die verschiedenen Stadien nämlich, die Kartoffeln, Runkelrüben oder Boviste bis zum Zerfall in ihr materielles Substrat durchlaufen, bieten fortgesetzt filigraner werdende Abwandlungen jener Strukturen, die bei ihm diese ganz besonderen Resonanzen auslösen. Zunehmend stärker geht er dabei über das hinaus, was ihm Kraut und Rüben an Gestaltungsvorschlägen anbieten. Er integriert eigene Formerfindungen, so daß Bilder einer quasi verwandtschaftlichen Beziehung entstehen, wobei ich ausdrücklich auf Ludwig Tieck und sein poetisches Statement „Blumen sind uns nah befreundet, Pflanzen unserm Blut verwandt...“ verweisen möchte. Es sind Bilder, die, wie es Astrid Brandt formulierte, „Momente des Glücks“ evozieren können – wie Musik, die uns besonders nahe geht. Koch selbst spricht in dem Zusammenhang von glücklichen Augenblicken der Kongruenz, die sich einstellen, wenn im Zuge der Arbeit erste Details seiner minutiös gezeichneten Grafit-Landschaften Gestalt annehmen. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, daß die verwandtschaftlichen Beziehungen ziemlich weit reichen. Zudem zeigt sich, daß wir es hier mit modernsten Naturbildern zu tun haben. Ein paar Beispiele: Sie stehen, meine Damen und Herren, vor der Kochschen „Agrarlandschaft“ und durch die Art der Gestaltung werden Ihnen darüber hinaus, wie aus weiter Entfernung fixiert – Stichwort „Satellit“ – landschaftliche Großereignisse gezeigt: ausbrechende Vulkane, aufgetürmte Wellen im Moment des Überschlags, Wüsten oder Schwemmland, das in Dürre erstarrt. Oder Sie betrachten das „Maisfeld“, die von Sand überwehten Gesteinsaufwürfe, die zu dunklen Mulden ausgetrockneten Pfützen, die Reflexe auf eingeschlossenen Kieseln und Sie haben zugleich – als sähen Sie durchs Mikroskop – Zusammenballungen von Bakterien vor Augen.
|
|
xxxx
Die Darstellung
schließlich des Abplatzens feiner Knochensplitter evoziert zwei
höchst unterschiedliche Vorstellungen: „Sonnen-Protuberanzen“
die eine, „Zellteilung“, die andere. D.h., es ergeben sich
Verbindungen zu Bildern und Modellen, wie sie von
Molekular-Biologen oder, einen Schritt weiter, von
Atom-Physikern erstellt werden, und zugleich meint man, durch
Superteleskope sehend den „Ozean der Stürme“, den „Tarantel“-
oder „Krebsnebel“ zu erkennen: Angesiedelt sind die Sujets – was
auch in den Titeln zum Ausdruck kommt – im
Mesokosmos,
in der für uns (mit „unbewaffneten Auge“) sichtbaren
Welt. Zugleich ergeben sich über die Form der Darstellung
Verknüpfungen zu Modellvorstellungen, die moderne
Naturwissenschaftler über
Mikro- und Makrokosmos
entwickelt haben.
Interessant ist in dem Zusammenhang die
2017 entstandene Zeichnung eines zerfallenden Bovisten, der Koch
den Titel „Churyumov Gerasimenko“ gegeben hat. Der Titel bezieht
sich auf den von Klym Churyumov und Svetlana Gerasimenko
entdeckten und nach ihnen benannten Kometen, der sich in ca. 600
Mill. km Entfernung von der Erde bewegt. Zuviel Ehre für einen
Bovisten? Aus nächster Nähe ins Auge gefaßt, werden auf dessen
Oberfläche eine Fülle differenzierter Texturen sichtbar, wie sie
– was die strukturelle Vielfältigkeit betrifft – auch auf den
Fotos der Raumsonde „Rosetta“ auftauchen, die den Kometen
begleitet hatte. Was sich dem Betrachter früherer Arbeiten
allein via Assoziation vermittelt (Abplatzen feiner
Knochensplitter → Sonnenprotuberanzen), wird hier durch den
Bildtitel avisiert: Daß es natürlich um die hochdetaillierte
Formulierung eines komplexen organischen Gebildes – hier eines
Bovisten – geht, zugleich aber oder darüber hinaus um die
Fixierung allumfassender, universeller Strukturen, die sich
ausbilden bei interstellaren Prozessen ebenso wie bei der
sukzessiven Auflösung eines Bovisten.
Weltbild im Maisfeld: Die Arbeiten der
80er und 90er Jahre zeigen – abgesehen von der spektakulären
Eins-zu-eins-Darstellung einer vertrockneten Königskerze
und weiteren Einzelobjekten (Fuchskadaver, Roter Fingerhut kurz
vor der Blüte, Kürbis kurz vor der Ernte) – primär
landwirtschaftliche Areale in herbstlichen Zustand, also mit
Maisstrünken, Kartoffelkraut und Runkelrüben.
"Tunguska", 2015 - (Ausschnitt)
xxxx xxxx
In beiden Arbeiten gibt es keinerlei Anhaltspunkte für
menschliches Eingreifen. Organische und anorganische Natur sind
unter sich! Dabei werden einzelne Pflanzen – Erlen, Sumpfgräser,
Schilfrohr – als vegetative
Individuen sichtbar, zeigen sich in dezenter,
geheimnisumwitterter melancholischer Anmut. Anschaulich wird
aber zugleich, wie sie – verwoben miteinander – die spezifische
Aura der jeweiligen Landschaft entstehen lassen, die sich von
den in einem Hamburger Naherholungsgebiet entstandenen
Stützfotos, von den konkreten
Anblicken also,
entfernt haben und eher als Projektionen, als
„Veröffentlichungen“ innerer
Bilder zu sehen sind: Von Kindheitserinnerungen durchwirkt,
klar; gleichermaßen stark aber auch von Gestaltungen geprägt,
auf die man in „weit entfernt“ liegender Wildnis stoßen könnte.
Nicht von ungefähr tragen die Zeichnungen Titel, denen etwas
Legendäres anhaftet:
Tunguska und Hinter
Tobolsk.
Schlußbemerkung: Angesichts des nur noch in
Terabytes zu messenden Zuwachses an Datenmaterial über die Natur
erscheint das in ihr gesuchte
Erlebnis, sich die
Gefühle bzw. Vorstellungen des Abgetrennt-Seins von der Welt
durch Fauna, Flora, Wind und Wetter wenigstens
kurzfristig vertreiben zu lassen, kaum noch möglich zu sein. Was uns
aber – früher oder später – aus der Bredouille helfen könnte,
ist die Verknüpfung von ästhetisch-emotionaler Einsicht und
wissenschaftlicher Erkenntnis. In Kochs Arbeiten deutet sich
eine solche Synthese an. Mit Superlativen sollte man vorsichtig
sein. Aber hier riskiere ich einen: Was die Originale zeigen,
die verpixelten Abbildungen seiner Grafit-Landschaften jedoch
allenfalls andeuten: Unter den Außenseitern der Kunstszene ist
Fritz Koch groß- und einzigartig!
Einführung in die Ausstellung im
„Kubus“, Hannover (2004) + Ergänzungen (ab 2015) |
| HOME | ||

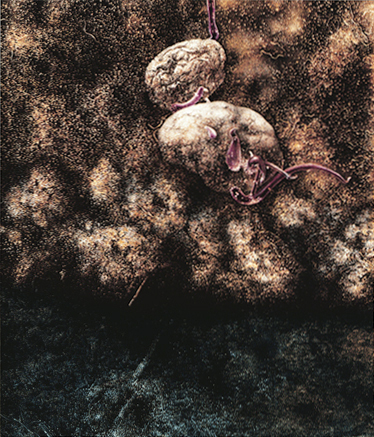



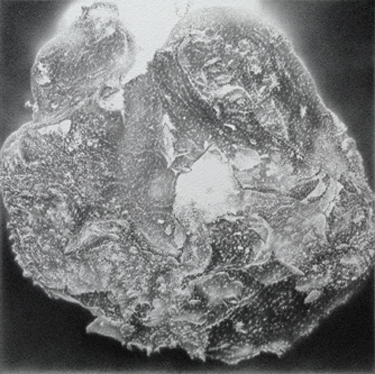
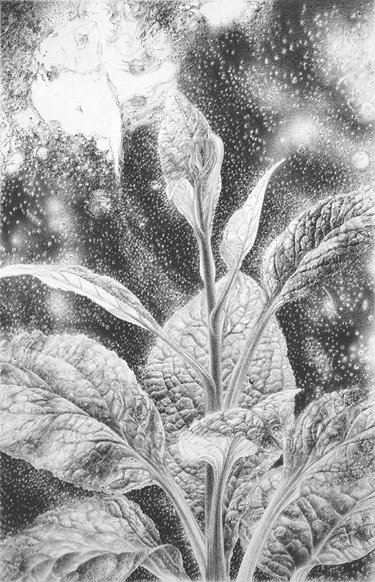

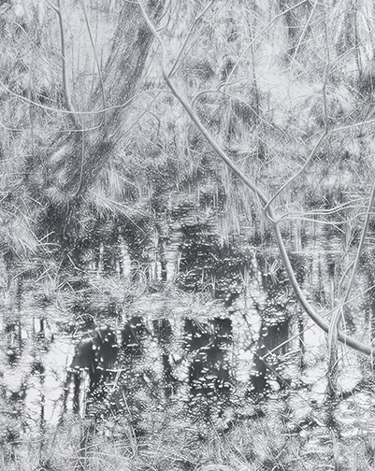

.jpg)